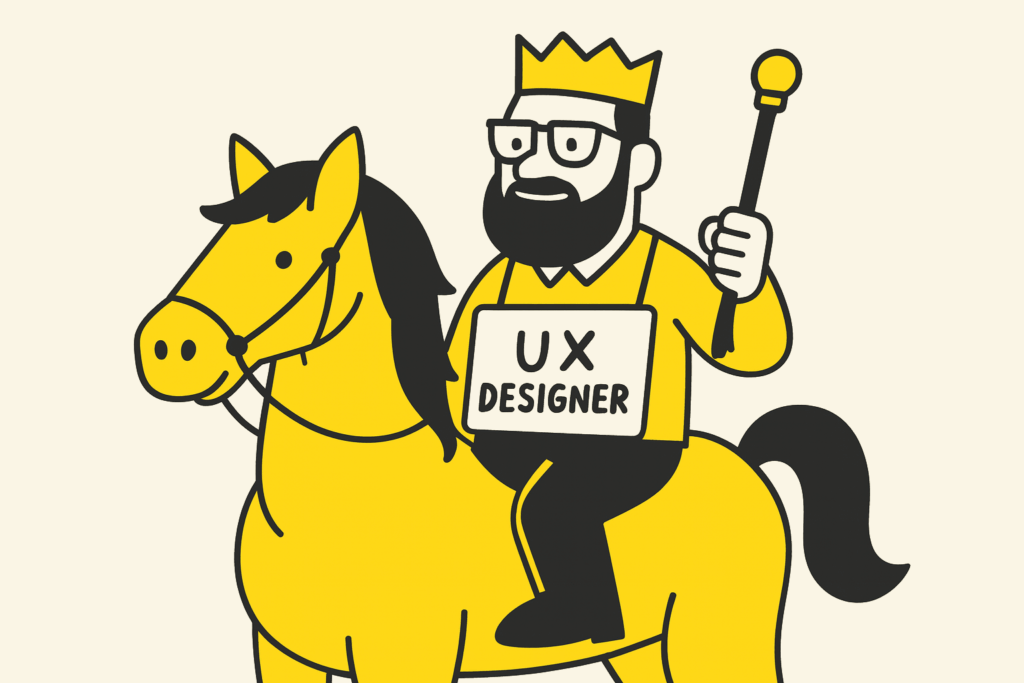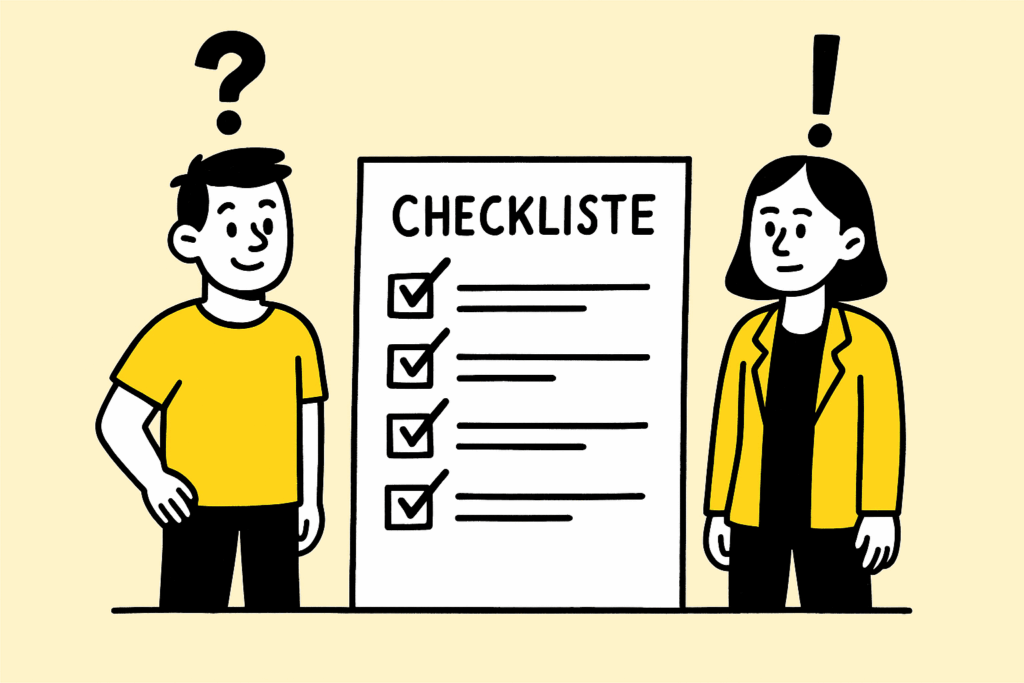UX ist Handwerk, keine Show
Für mich fühlt sich UX manchmal wie Theater an: Wenn UX-Designer:innen sich als intellektuelle Elite inszenieren – mit ganz viel Pathos und pseudo-wissenschaftlichem Jargon, dann hat das fast schon satirische Züge. Da werden mit großen Gesten große Worte geschwungen, als würde man mit jedem Wireframe die Welt neu vermessen – und am Ende geht es lediglich um die Position eines Buttons. Ganz ehrlich: Wer das Handwerk beherrscht, braucht keine göttliche Aura, sondern Präzision und Pragmatismus.
Kein Hochglanz: Gute UXler gehen dahin, wo’s schmutzig wird
UX ist kein poliertes Prestigeprojekt, sondern Arbeit im Detail. Wer gute Interfaces baut, muss dahin gehen, wo es unbequem wird: zu den echten Nutzer:innen, in die unaufgeräumten Prozesse, in die kleinen Stolperfallen, die niemand in der Hochglanz-Präsentation zeigen will. Genau dort entscheidet sich, ob ein Produkt funktioniert – oder nur so tut als ob.
Großes Theater, wenig Substanz
Besonders skeptisch werde ich immer, sobald UX-Designer das ganz große Besteck auspacken. Denn die Erfahrung zeigt: Je größer die Show, umso weniger Substanz steckt dahinter. „User Journeys“ werden dann wie spirituelle Erweckungserlebnisse verkauft, Interviews mit drei Testpersonen mutieren zur „Feldforschung“, und wer einmal ein Flowchart gemalt hat, spricht plötzlich von „Menschenzentrierter Transformation“. Das ist kein UX, das ist Selbstverliebtheit mit PowerPoint. Wer so auftritt, verkauft Inszenierung, nicht Erkenntnis. Und genau darin liegt das Problem: Hochglanz ersetzt Handwerk, Pose ersetzt Beobachtung, und am Ende bleibt ein glänzendes Deckblatt ohne Substanz. Theater statt Praxis. Diese Wichtigtuerei schadet mit realen Folgen:
- Designer verlieren Glaubwürdigkeit, weil sie sich selbst wichtiger nehmen als die Aufgabe.
- Teams verlieren Zeit, weil Diskussionen über Begriffe wichtiger werden als Ergebnisse.
- Produkte verlieren Fokus, weil die Show im Meeting wichtiger ist als der Test mit echten Nutzer:innen.
Titel ohne Substanz
Besonders wichtig: Jeder darf sich „UX-Designer:in“ nennen. Es ist kein geschützter Beruf, keine vorgeschriebene Ausbildung. Man kann sich den Titel selbst auf die Visitenkarte drucken, ohne jemals ein einziges Kunden-Interview gemacht oder einen Prototypen getestet zu haben. Die Berufbezeichnung „UX-Designer:in“ alleine ist ungefähr so glaubwürdig wie „Chief Sandwich Experience Officer“.
Gleichzeitig hat dies auch einen großen Vorteil: Man braucht keine zehn Jahre Studium, um eine Navigation zu bauen. Man muss keine „Empathie-Methodik“ erfinden, um herauszufinden, dass Nutzer:innen Klarheit mögen. UX ist kein akademisches Hochamt, sondern schlicht die Kunst, Dinge benutzbar zu machen. Und das kann jeder lernen.
Ich bin das beste Gegenbeispiel
Wenn das jemand beweisen kann, dann ich: Ich habe Anfang der 1990er als Jugendlicher angefangen, Webseiten zu bauen – mit HTML, Tabellenlayouts und blinkenden GIFs –, lange bevor sich das Berufsbild „UX-Designer:in“ etabliert hatte. Nach Abitur und Zivildienst folgten eine abgebrochene Ausbildung als Mediengestalter, diverse Agentur-Jobs, eine freiberufliche Tätigkeit, nebenbei ein Studium der Nahostwissenschaften (mit null Bezug zu meinem Beruf) sowie ein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften, das mich in der Praxis überhaupt nicht weitergebracht hat.
Und ja, ich habe sogar ein sogenanntes „UX-Bootcamp“ absolviert. Das war lustig, es gab jede Menge Post-its, Double Diamonds und „Empathie-Übungen“. Aber neue Erkenntnisse? Fehlanzeige! Für jemanden, der seit den 90ern durchgehend digitale Erlebnisse baut, war das eher Buzzword-Bingo als eine Offenbarung.
Mein Werdegang ist alles andere als geradlinig, aber er zeigt: Erfahrung schlägt Zertifikat. Für gute UX braucht man keine Titel, keine Zertifikate und keine akademischen Hochglanzfassaden. Aber ich habe mein Fach von der Pieke auf gelernt: im Quellcode, in Projekten, im Austausch mit Kund:innen und im direkten Kontakt mit Nutzer:innen. Und genau deshalb weiß ich: UX ist Handwerk. Solide, manchmal schmutzig, aber immer ehrlich.
Fazit: Weniger Ego, mehr Ergebnis
UX-Designerinnen sind keine Gurus, keine Philosophinnen, keine Wissenschaftlerinnen. Sie sind Handwerkerinnen. Gute UX entsteht nicht durch Pathos, sondern durch Pragmatismus. Wer das nicht akzeptiert, produziert mehr heiße Luft als nutzbare Interfaces – und sollte dringend die Bühne räumen, bevor die Nutzer kollektiv einschlafen. Und abgesehen davon: Die besten Interfaces sind die, die gar nicht auffallen. Kein Nutzer denkt: „Wow, diese Journey war aber akademisch durchdacht.“ Sie denken: „Ah, das funktioniert.“ Punkt. Ironischerweise ist UX also gerade dann am besten, wenn niemand darüber spricht.